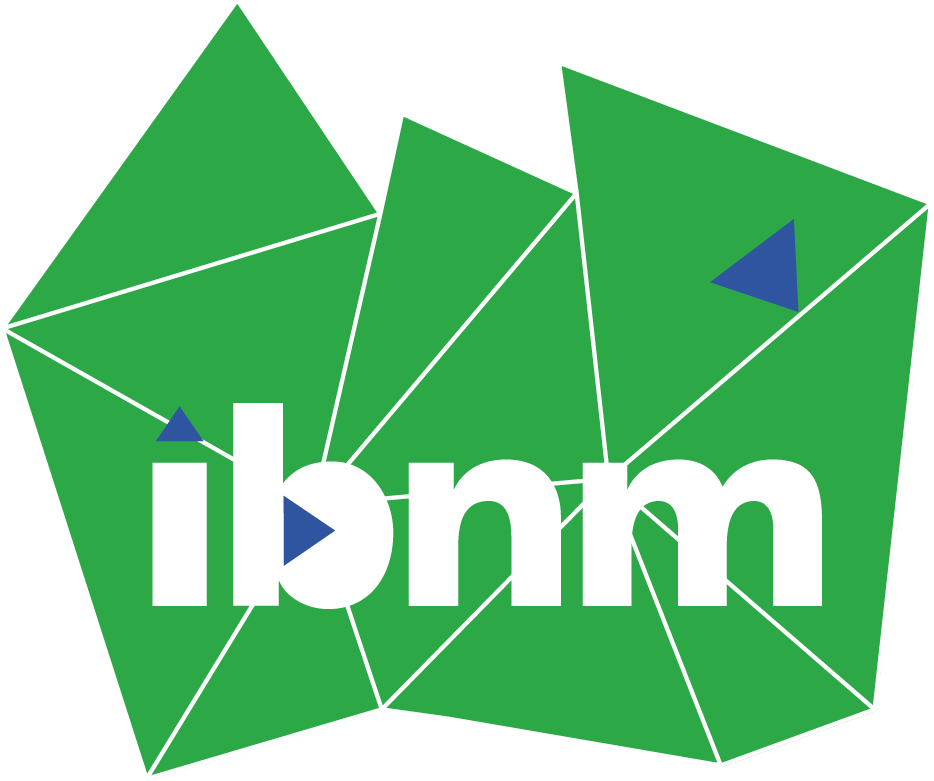Gute Wärmedämmung an Gebäuden hat oft eine unschöne Begleiterscheinung: Die dünne Putzschicht auf der Dämmung kühlt schnell aus; nach Regen und bei Taubildung bleibt sie länger feucht. Darauf fühlen sich Algen und Pilze wohl, was den jeweiligen Hausbesitzern allerdings optisch weniger gefällt. Bekämpft wird dieser Bewuchs bislang überwiegend mit bioziden Wirkstoffen, die jedoch von den Oberflächen mit der Zeit abgewaschen werden und so in Böden und Gewässer gelangen können - eine wenig umweltfreundliche Methode.
Mikrobieller Bewuchs: Alternative zu bioziden Wirkstoffen gesucht
Dr.-Ing. Heide Ackerbauer hat sich in ihrer Dissertation am Institut für Bauphysik systematisch mit dieser Problematik befasst und eine Methodik entwickelt, mit der sich die Feuchtigkeit an den Oberflächen berechnen und damit abschätzen lassen soll, ob und wie sich der Bewuchs auf den Wänden unter verschiedenen Bedingungen entwickeln wird. "Hauptantrieb meiner Forschungsarbeit war es, ingenieurtechnische Ansätze auf bauphysikalischer Basis zu finden, mit denen eine Alternative zu den bisher verwendeten chemischen Lösungen angeboten werden kann", erklärt die Bauingenieurin.
Wärmedämmung: Wo sammelt sich Feuchtigkeit an der Oberfläche?
Zunächst beobachtete Ackerbauer längerfristig Gebäude mit verschiedenen Wärmedämmverbundsystemen, die mikrobiell bewachsen sind. Sämtliche Messtechnik für ihre experimentellen Untersuchungen entwickelte und konzeptionierte sie selbst. Gemeinsam mit ihren Kollegen entwarf, baute und installierte sie in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Andreas O. Rapp vom Institut für Berufswissenschaften im Bauwesen auf dem Dach eines Gebäudes der Leibniz Universität in Hannover-Herrenhausen einen "Algen-Pilze-Würfel". Bei diesem Langzeitexperiment bestehen die Seiten des Würfels aus verschiedenen Außenwandkonstruktionen und sind der Witterung frei ausgesetzt. Der Clou dabei: Die Wände sehen im Querschnitt wie Keilkissen aus; die Dämmschicht wird stufenlos von oben nach unten immer dicker. Ein weiteres Keilkissen darüber bildet eine ebenfalls stufenlos ansteigende Putzschicht von rechts nach links. So lässt sich untersuchen, in welchen Bereichen der Oberflächen sich häufiger Feuchtigkeit ansammelt und damit auch mehr Algen und Pilze wachsen. Für das optische Messprinzip, das Ackerbauer dafür entwickelte, hält sie zusammen mit Dr.-Ing. Torsten Richter (Institut für Bauphysik) mittlerweile ein eingetragenes Gebrauchsmuster.
Neue Kenngröße entwickelt
Für die Auswertung der Messdaten holte sich Ackerbauer Unterstützung durch das Team um Prof. Dr.-Ing. Michael Beer vom Institut für Risiko und Zuverlässigkeit. So entstand eine Software, mit der sich die Zeiträume mit nasser Oberfläche automatisch auswerten lassen. Die Messdaten hat Ackerbauer anschließend numerisch nachgebildet und ein Rechenmodell entwickelt, das die Oberfläche eines Materials darstellen kann. Aus den ermittelten Messdaten und nachgelagerten Langzeitsimulationen ließen sich mathematische Muster erkennen, aus denen ein neuer Faktor zur Beschreibung feuchteinduzierter Bewuchsentwicklung und auch erste Grenzwerte abgeleitet werden konnten. Die neue Kenngröße, die Oberflächenfeuchteintensität t’w,Sep-Jan, berücksichtigt alle denkbaren baulichen und standortabhängigen Einflüsse und kann somit für die Beurteilung und Bemessung zur Anwendung kommen.
Vorschläge für Auslegung von Außenwänden
Über Parameterstudien entwickelte Ackerbauer dann Vorschläge, wie sich Außenwände je nach den Umgebungsfaktoren auslegen lassen. Hier können verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten wie etwa die Dämmstoffdicke, die oberflächennahe Speichermasse oder die Saugfähigkeit der oberflächennahen Schichten oder die Umgebungsluftfeuchte eines Bauwerks variiert werden.
"Ich hoffe sehr, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag zu Klima- und Naturschutz leisten konnte und weiterhin kann", sagt Ackerbauer, die mittlerweile an der Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik Hannover (MPA) die Abteilung Dämmstoffe und Brandverhalten von Baustoffen, Bauphysik leitet.
Weitere Informationen:
Kontakt für Informationen zum Projekt:
Dr.-Ing. Heide Ackerbauer, MPA Hannover: ackerbauer@mpa-hannover.de
Dr.-Ing. Torsten Richter, Institut für Bauphysik: richter@ifbp.uni-hannover.de
- Originalpublikation "Vorhersage feuchteinduzierter Bewuchsentwicklung auf Außenwandoberflächen"(zum Download)