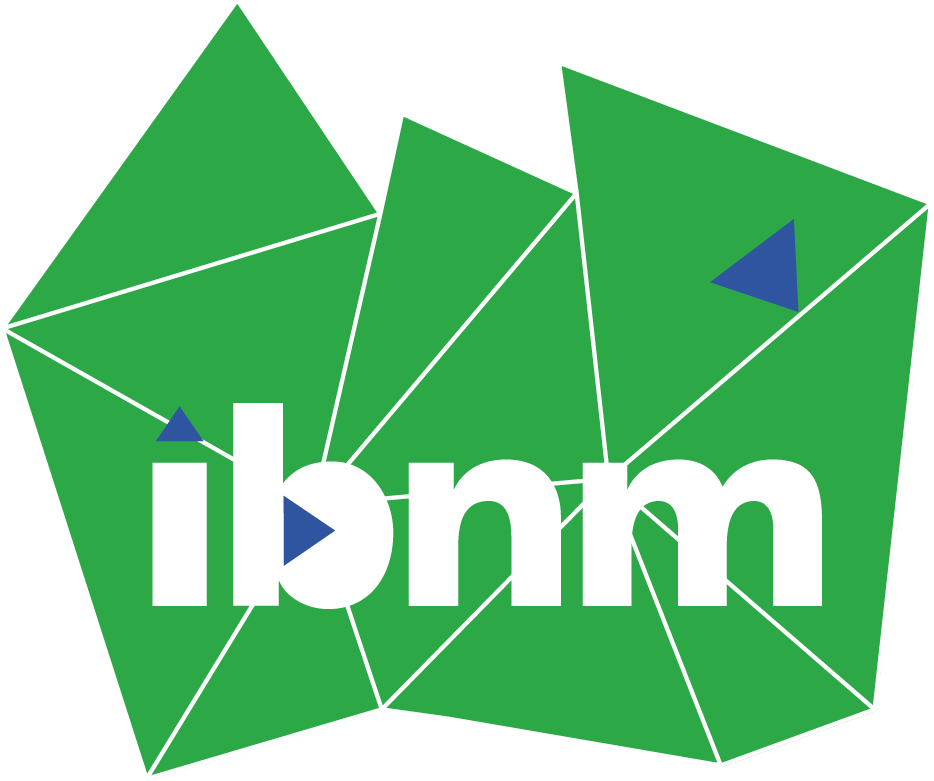Pressemitteilung der Leibniz Universität Hannover
Die umfangreichen Umbauarbeiten im Großen Wellenkanal (GWK) von Leibniz Universität Hannover und Technischer Universität Braunschweig sind in vollem Gange. Während eines Ortstermins auf der Baustelle in Hannover-Marienwerder ist jetzt der Öffentlichkeit die im Sommer eingebaute neue Wellenmaschine präsentiert worden.
„Dies ist die weltweit größte, jemals gebaute Wellenmaschine, die uns ganz neue Möglichkeiten der Forschung eröffnen wird“, erläutert Prof. Dr.-Ing. Torsten Schlurmann vom Ludwig-Franzius-Institut für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen der Leibniz Universität Hannover (LUH). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Vertreterinnen und Vertreter des Baudezernats, der Fachplanung und Bauunternehmung standen für Fragen und Erklärungen rund um die beeindruckende Maschine, das technische Umfeld und den Hintergrund der Erweiterungen zur Verfügung.
„Der neue GWK+ wird im ersten Halbjahr 2023 zunächst in ausgewählten Pilotprojekten zur Zukunft der Energieversorgung wieder in den Betrieb gehen“, kündigt Prof. Dr.-Ing. Nils Goseberg vom Leichtweiß-Institut der TU Braunschweig an. Prof. Goseberg und Prof. Schlurmann gehören dem Direktorium des Forschungszentrums Küste (FZK) von LUH und TU Braunschweig an, unter dessen Ägide der GWK betrieben wird.
Der 300 Meter lange GWK in Hannover-Marienwerder wurde im Jahr 1983 in Betrieb genommen. Zahlreiche richtungweisende Forschungsprojekte zur Interaktion von Wellen mit den unterschiedlichsten Infrastrukturen sind hier erfolgreich durchgeführt worden. Bisher konnten im GWK aber ausschließlich Wellen erzeugt werden. Mit dem Ziel des Ausbaus mariner erneuerbarer Energien (Offshore-Windenergie, Tide-/Wellenenergie u.a.) rücken Installations- und Betriebskonzepte über den Lebenszyklus dieser Bauwerke sowie der Einfluss von Gezeitenströmungen stärker in den Fokus. Im Jahr 2017 bewilligte das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK, vormals BMWi) das Forschungsprojekt marTech (maritime Technologien), um in den Großen Wellenkanal Hannover mit mehr als 35 Millionen Euro eine leistungsfähige Strömungsanlage, einen Tiefteil zur Untersuchung der Einbettung von Gründungsstrukturen und eine hochleistungsfähige Wellenmaschine einzubauen und zukünftig zu betreiben.
Mit der Erweiterung des GWK wird in Hannover eine weltweit einmalige Versuchseinrichtung geschaffen. Hier können Forschende künftig die gleichzeitige Belastung aus Seegang und Strömung in großem Maßstab und damit realitätsnah untersuchen. Steilere und höhere Wellen, wie sie durch den Klimawandel prognostiziert werden, können dann auch im Experiment nachgestellt werden. Mit der ebenfalls neuen, umlaufenden Strömungsanlage können erstmalig Tideströmungen wie im Meer untersucht werden. Der neue Tiefteil ermöglicht es, auch den im Boden befindlichen Teil von Offshore-Windenergieanlagen zu simulieren und die dort stattfindenden Bewegungen von Boden und Anlage zu untersuchen.
Zur Pressemitteilung der Leibniz Universität Hannover
Zur Pressemitteilung der Technischen Universität Braunschweig